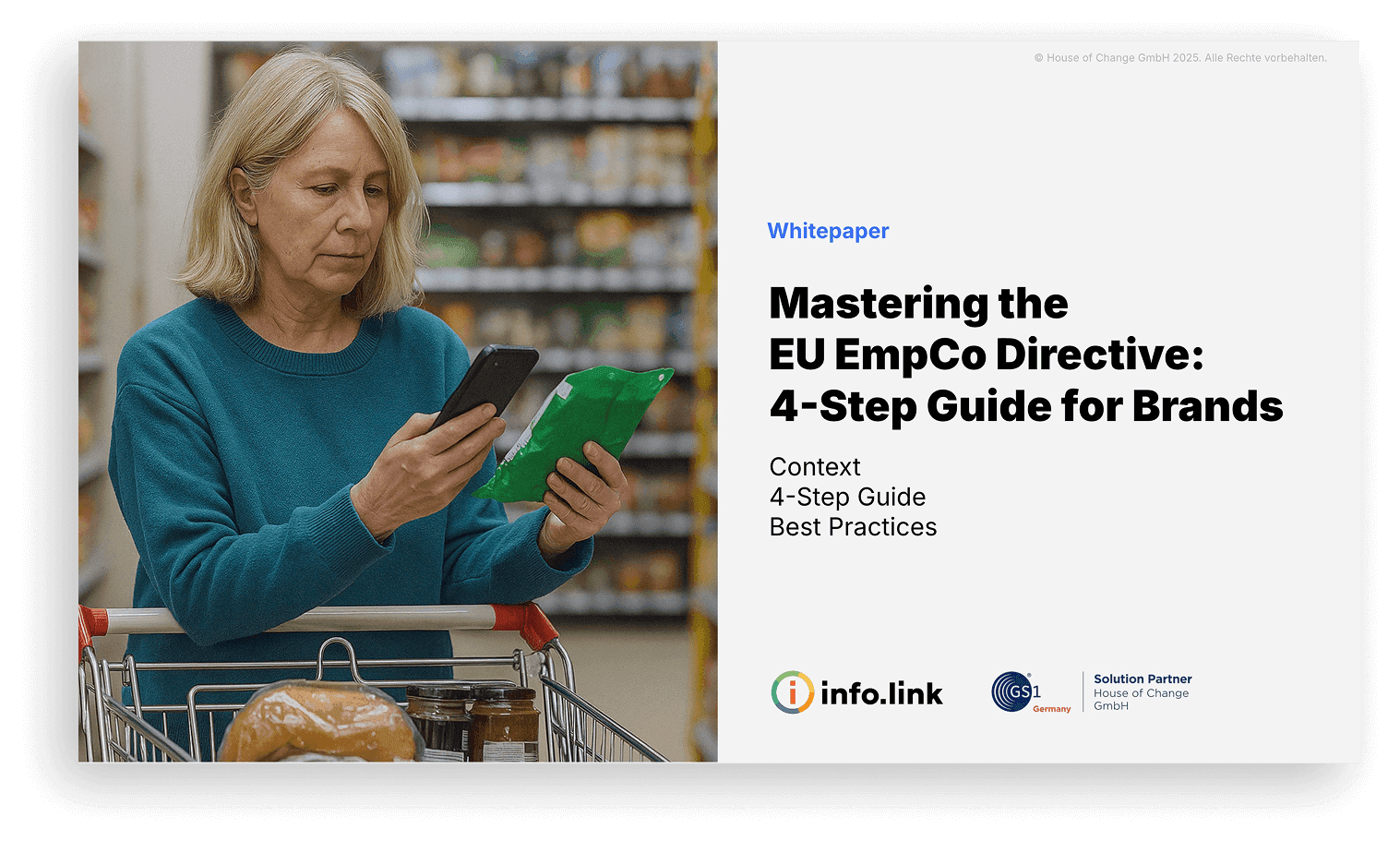Ultimative Guide zur EU Empowering Consumers Richtlinie (EmpCo)

I. Das Ende irreführender Umweltversprechen (Green Claims)
Verbraucher wollen bewusster einkaufen – aber sie glauben nicht mehr, was ihnen versprochen wird. Nachhaltige Produkte sind längst kein Nischenthema mehr: 54 % der Konsumenten geben an, dafür mehr zu zahlen; 2022 waren es noch 35 % (Simon-Kucher Global Sustainability Study 2024). Doch das Verhalten wird nicht von Vertrauen begleitet. Nur 9 % glauben den Nachhaltigkeitsaussagen von Marken (laut einer aktuellen YouGov-Umfrage in 18 internationalen Märkten). Der Rest ist skeptisch (55 %) oder gleichgültig (31 %).
Für Marken ist das weit mehr als ein Imageproblem, es ist ein strategischer Engpass. Nachhaltiger Konsum wächst, aber stößt an Grenzen – wegen eines massiven Glaubwürdigkeitsdefizits. Die EU-Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel (Empowering Consumers Directive) weist den Weg: Sie schafft klare Regeln für Transparenz, sanktioniert Greenwashing und gibt Konsumentinnen, was sie wirklich wollen: Belege statt Behauptungen.
Die Empowering Consumers Directive (EmpCo) verstehen
Die Europäische Union hat ihre Maßnahmen gegen Greenwashing deutlich verschärft mit der Empowering Consumers Directive (EmpCo oder auch ECGT Richtlinie), offiziell bekannt als Richtlinie (EU) 2024/825. Diese Richtlinie ändert sowohl die bestehende Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UCPD bzw. Directive 2005/29/EC) als auch die Verbraucherrechte-Richtlinie (CRD) und ist ein zentraler Bestandteil des umfassenderen „European Green Deal“-Programms der EU.
Was ist das zentrale Ziel?
Das zentrale Ziel von EmpCo ist es, Verbraucher vor irreführenden Marketingpraktiken im Bereich Nachhaltigkeit zu schützen und ihnen transparente, fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Durch konkrete Vorgaben will die EU unlauteren Geschäftspraktiken entgegenwirken, die den Zugang zu wirklich nachhaltigen Produkten erschweren – etwa in Bezug auf frühzeitige Obsoleszenz, irreführende ökologische und soziale Werbeaussagen oder fragwürdige Nachhaltigkeitssiegel. Die Initiative zahlt auf das EU-Ziel ein, bis 2050 klimaneutral zu werden und eine stärker kreislauforientierte Wirtschaft zu fördern.
Ab wann gilt die Richtlinie?
Die EmpCo-Richtlinie wurde am 17. Januar 2024 vom EU-Parlament verabschiedet und am 20. Februar 2024 vom Rat der EU angenommen. Sie wurde am 6. März 2024 veröffentlicht und ist am 26. März 2024 offiziell in Kraft getreten.
Das ist der Zeitplan für Unternehmen:
- 27. März 2026: Bis zu diesem Datum müssen alle EU-Mitgliedstaaten die Vorgaben in nationales Recht überführen.
- 27. September 2026: Ab diesem Tag gelten die neuen Regelungen verbindlich.
Wichtig ist: Schon vor der vollständigen Umsetzung von EmpCo beginnt sich die Rechtsprechung an ihren Inhalten auszurichten. Irreführende Umweltaussagen in der Werbung sind längst wettbewerbsrechtlich angreifbar. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27. Juni 2024 gilt bereits als Beispiel für die Umsetzung zentraler EmpCo-Vorgaben und zeigt: Die Anforderungen an glaubwürdige Umweltwerbung steigen spürbar.
EmpCo vs. Green Claims Directive: Was Unternehmen wissen müssen
Die EmpCo-Richtlinie ist nur ein Teil der umfassenden EU-Strategie gegen Greenwashing. Ergänzt wird sie durch den Entwurf der „Green Claims Directive“. Diese soll detaillierte Anforderungen an die Begründung und Kommunikation konkreter Umweltaussagen festlegen. Vorgesehen ist unter anderem ein System zur Vorab-Prüfung durch unabhängige Stellen sowie spürbare Sanktionen, etwa Geldstrafen in Höhe von mindestens 4 % des Jahresumsatzes.
Wichtig: Auch wenn sich das Gesetzgebungsverfahren zur Green Claims Directive verzögert hat und die EU-Kommission am 20. Juni 2025 sogar ihre Absicht bekundet hat, den Vorschlag zurückzuziehen, bedeutet das keineswegs, dass Unternehmen nun freie Hand bei Umweltwerbung haben. Dieser Beitrag zeigt, dass die Empowering Consumers Directive (EmpCo) bereits heute über ausreichend klare und verbindliche Regeln verfügt, um irreführende Umweltaussagen zu verhindern und Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen.
Warum das für Marken relevant ist
Es geht hier nicht nur um ein juristisches Update, sondern um einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen über Nachhaltigkeit kommunizieren müssen. Marketingaussagen und Produkte sollten deutlich vor 2026 kritisch überprüft werden, um den neuen, strengeren Anforderungen gerecht zu werden. Die Richtlinie verlangt konkrete, überprüfbare Pläne für zukünftige Umweltaussagen und sieht eine unabhängige Kontrolle der Fortschritte durch Dritte vor. Besonders herausfordernd ist zudem das Verbot von Aussagen, die sich allein auf Kompensation stützen; ein Problem für viele global ausgerichtete Werbestrategien. Am Ende gilt: Green Claims müssen überarbeitet werden: sie müssen klar, fair, belastbar sein und den Verbrauchern wirklich helfen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.

II. Green Claims verstehen: Definition und Wirkung
Hier liegt der Kern der Herausforderung für Marken im grünen Wandel. Die Empowering Consumers Directive definiert grundlegend, wie Umweltversprechen künftig formuliert werden dürfen. Es genügt nicht mehr, Gutes zu tun. Man muss es auch klar und konsistent belegen können.
Was ist ein „Green Claim“? Weiter gefasst als man denkt
Laut der EmpCo-Richtlinie ist ein „Umweltversprechen“ (auch bekannt als „Green Claim“) sehr weit gefasst. Gemeint ist jede Botschaft oder Darstellung, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, weder durch EU- noch durch nationales Recht. Dazu zählen Aussagen in jeglicher Form, etwa:
- Texte: Slogans, Produktbeschreibungen, Website-Texte
- Bildelemente: Fotos, Infografiken
- Grafische Elemente: Logos, Symbole, Icons
- Symbolische Darstellungen: Labels, Zertifizierungen
- Markenelemente: Markennamen, Unternehmensnamen, Produktnamen selbst
Entscheidend ist, dass die Aussage im Rahmen einer kommerziellen Kommunikation erfolgt und ausdrücklich oder indirekt vermittelt, dass ein Produkt, eine Produktgruppe, eine Marke oder ein Unternehmen:
- eine positive oder neutrale Umweltwirkung hat
- weniger umweltschädlich ist als andere
- seine Umweltwirkung im Laufe der Zeit verbessert hat
Diese breite Definition umfasst unter anderem Aussagen zu Klimawirkung, Energieeffizienz, Kreislauffähigkeit, Umweltverschmutzung oder Biodiversität. Ob es sich also um einen Produktnamen wie „Green Clean“ handelt oder um ein Logo mit der Aufschrift „Klimaneutral“, EmpCo ist anwendbar.
Was ist „Greenwashing“ (und warum Marken es vermeiden sollten)
Greenwashing wird in der EmpCo-Richtlinie klar definiert als eine unzutreffende, unbelegte oder nicht überprüfbare Umweltaussage.
Das ist ein zentraler Punkt:
Selbst wenn ein Unternehmen tatsächlich nachhaltig handelt, gilt: Wenn entsprechende Aussagen nicht sorgfältig belegt und nicht durch eine glaubwürdige externe Stelle überprüft werden, kann das trotzdem als Greenwashing gewertet werden. Entscheidend ist nicht nur das Handeln, sondern auch der Nachweis.
Marken sollten Greenwashing unbedingt vermeiden – aus rechtlichen und reputationsbezogenen Gründen:
- Rechtliche Schritte: In den meisten Ländern kann irreführende Umweltwerbung bereits heute als Wettbewerbsverstoß geahndet werden. Mit der EmpCo-Richtlinie wird dieser Schutz deutlich ausgeweitet. Sie führt sogenannte „per se“-Verbote ein, bei denen bestimmte Praktiken immer als unlauter gelten, unabhängig vom Einzelfall. Eine gerichtliche Einzelfallprüfung ist nicht erforderlich. Konkurrenten und qualifizierte Verbraucherverbände können rechtlich gegen Verstöße vorgehen, etwa durch Abmahnungen.
- Strengere Sanktionen: Auch wenn EmpCo bestehende Regelungen verschärft, zeigt der (derzeit verzögerte oder zurückgezogene) Vorschlag zur Green Claims Directive, wohin die Reise geht: Er sieht unter anderem Bußgelder von mindestens 4 % des Jahresumsatzes und Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen vor. Selbst ohne diese zusätzliche Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Verstöße gegen EmpCo mit wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktionen geahndet werden.
- Imageschäden: Neben rechtlichen Konsequenzen kann der Vorwurf des Greenwashings auch erheblichen Reputationsschaden verursachen und das Vertrauen der Kunden zerstören. Laut einer vom Handelsblatt zitierten Umfrage des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen (NIM) meiden 72 % der Befragten Unternehmen, die mit fragwürdigen Klimaschutzversprechen in Verbindung gebracht werden. Schon der Verdacht reicht aus, um Konsumenten abzuschrecken.
III. Verbotene Praktiken: Was Marken nicht mehr dürfen
Die EmpCo-Richtlinie erweitert die sogenannte „schwarze Liste“ unlauterer Geschäftspraktiken. Sie ergänzt neue Kategorien von Verhaltensweisen, die in jedem Fall verboten sind, weil sie als grundsätzlich unfair gelten. Eine gerichtliche Einzelfallprüfung ist dafür nicht mehr notwendig.
Klare Verbote: Was Marken künftig NICHT mehr behaupten dürfen
- Allgemeine Umweltaussagen:
- Eine „allgemeine Umweltaussage“ ist laut EmpCo jede Umweltbehauptung in schriftlicher oder mündlicher Form, auch über audiovisuelle Medien, die nicht Teil eines anerkannten Nachhaltigkeitslabels ist und nicht auf demselben Medium eindeutig und deutlich spezifiziert wird.
- Allgemeine Aussagen wie „umweltfreundlich“, „klimafreundlich“, „ökologisch“, „grün“, „naturverträglich“, „biologisch abbaubar“, „energieeffizient“ oder „CO₂-freundlich“ sind künftig verboten, wenn das Unternehmen keine anerkannte herausragende Umweltleistung nachweisen kann, die sich konkret auf die Aussage bezieht. Eine anerkannte herausragende Umweltleistung liegt nur dann vor, wenn sie durch spezifische EU-Rechtsakte (z. B. EU-Umweltzeichen gemäß Verordnung (EG) Nr. 66/2010), durch nationale oder regionale ISO-14024-Typ-I-Umweltzeichen oder durch Spitzenleistungen gemäß EU-Recht belegt ist.
- Beispiele:
- Früher: Ein Produkt mit der bloßen Aussage „klimafreundlich“ oder „umweltfreundlich“ zu bewerben.
- Jetzt: Aussagen wie „klimafreundliche Verpackung“ gelten als generisch und sind ohne Nachweis unzulässig. Eine präzise Aussage wie „100 % der für diese Verpackung eingesetzten Energie stammt aus erneuerbaren Quellen“ gilt allerdings als spezifisch. Sie fällt nicht unter dieses Verbot – kann aber weiterhin durch andere Vorschriften der UGP-Richtlinie (UCPD) reguliert werden. Auch Begriffe wie „nachhaltig“ oder „verantwortungsvoll“ sind weiterhin kritisch zu betrachten, wenn sie sich ausschließlich auf ökologische Aspekte stützen. Diese Begriffe erfassen auch soziale Merkmale und dürfen nicht pauschal verwendet werden.
- Irreführende Gesamtbehauptungen: Es ist unzulässig, eine Umweltaussage über das gesamte Produkt oder das gesamte Unternehmen zu treffen, wenn sich die Aussage tatsächlich nur auf einen bestimmten Aspekt des Produkts oder auf eine einzelne, nicht repräsentative Aktivität des Unternehmens bezieht.
- Beispiel: Wenn ein Produkt unter dem Namen „Green Cream“ vermarktet wird und damit der Eindruck eines durchweg umweltfreundlichen Produkts entsteht, obwohl lediglich die Verpackung zu 30 % aus recyceltem Material besteht, gilt das künftig als irreführend. Ebenso unzulässig ist es, zu behaupten, ein Produkt sei „aus recyceltem Material“, wenn dies nur auf die Verpackung zutrifft. Auch der Eindruck, ein Unternehmen arbeite ausschließlich mit erneuerbaren Energien, während einzelne Standorte weiterhin fossile Energiequellen nutzen, ist künftig verboten.
- Kompensation-Claims (”Offsetting”): Ein zentrales Verbot betrifft Umweltaussagen, die auf der Kompensation von Treibhausgasemissionen basieren. Gemeint ist die Behauptung, ein Produkt habe eine neutrale, verringerte oder positive Auswirkung auf die Umwelt, obwohl diese Wirkung nicht aus dem Produkt selbst oder dessen Herstellungsprozess stammt.
- Beispiele dafür sind Aussagen wie „klimaneutral“, „CO2-neutral zertifiziert“, „klimapositiv“, „Netto-null beim Klima“, „klimakompensiert“, „verringerte Klimaauswirkungen“ oder „begrenzter CO2-Fußabdruck“. Solche Aussagen sind unzulässig, weil sie beim Verbraucher den Eindruck erwecken können, das Produkt oder seine Lieferung hätte keine Umweltauswirkungen. Erlaubt sind solche Aussagen nur, wenn sie sich auf die tatsächlichen Auswirkungen innerhalb des Produktlebenszyklus und der eigenen Wertschöpfungskette beziehen. Kompensationen außerhalb dieser Kette, etwa durch Zertifikatskäufe, werden nicht als gleichwertig anerkannt. Das stellt eine deutliche Veränderung für viele Marken dar, die bislang stark auf CO2-Kompensation gesetzt haben. Investitionen in Umwelt- oder Klimaschutzprojekte, einschließlich Kompensationsprojekte, dürfen jedoch weiterhin kommuniziert werden, solange die Informationen transparent und nicht irreführend dargestellt sind.

- Irreführende Produktvergleiche: Es ist unzulässig, Produkte anhand von Umwelteigenschaften miteinander zu vergleichen, ohne dabei klare, ausreichende und aktuelle Informationen zur Vergleichsmethodik, zu den verglichenen Produkten und Anbietern sowie zu den Maßnahmen zur Aktualisierung der Angaben bereitzustellen. Dazu zählt auch das Weglassen von methodischen Angaben bei direkten Vergleichen.
- Beispiel: Eine Aussage wie „Weniger Wasser als andere Produkte!“ auf der Verpackung, ohne nähere Informationen zur verwendeten Vergleichsmethode, wird nach den neuen Vorgaben als irreführend eingestuft. Ebenso gilt: Wenn eine Marke einen Service anbietet, der Umweltmerkmale von Produkten vergleicht, müssen die angewandte Methode, die einbezogenen Produkte und Anbieter sowie die Art der regelmäßigen Aktualisierung dieser Daten offengelegt werden.
- Selbstverständliche Aussagen: Es ist verboten, gesetzliche Anforderungen, die für alle Produkte einer bestimmten Produktkategorie auf dem Unionsmarkt gelten, als besonderes Merkmal des eigenen Angebots darzustellen.
- Beispiel: Wenn zum Beispiel ein „30 % Recyclinganteil“ gesetzlich vorgeschrieben ist oder eine „Rezeptur ohne Mikroplastik“ bereits branchenweiter Standard ist, darf dies nicht als besonderer Vorteil des eigenen Produkts beworben werden. Ziel dieser Regelung ist es, zu verhindern, dass Unternehmen aus der Einhaltung allgemeiner gesetzlicher Vorgaben einen werblichen Wettbewerbsvorteil ziehen.
- Frei erfundene Nachhaltigkeitslabel: Die Richtlinie verbietet es, ein Nachhaltigkeitssiegel zu verwenden, das nicht auf einem Zertifizierungssystem beruht oder nicht von einer öffentlichen Stelle eingeführt wurde. Das bedeutet, dass selbst entwickelte Nachhaltigkeitslabel künftig nicht mehr zulässig sind.
- Ein „Nachhaltigkeitslabel“ ist definiert als jedes freiwillige Vertrauenszeichen, Qualitätssiegel oder vergleichbare Kennzeichnung, öffentlich oder privat, das darauf abzielt, ein Produkt, einen Prozess oder ein Unternehmen anhand seiner Umwelt- oder Sozialmerkmale oder beider hervorzuheben und zu bewerben. Davon ausgenommen sind verpflichtende Kennzeichnungen, die durch EU- oder nationales Recht vorgeschrieben sind.
- Damit ein Siegel erlaubt ist, muss es entweder:
- von einer öffentlichen Stelle eingeführt worden sein. Beispiele dafür sind das EMAS-Logo (Eco-Management and Audit Scheme) oder das EU-Umweltzeichen (EU Ecolabel) oder
- auf einem „Zertifizierungssystem“ beruhen. Ein Zertifizierungssystem ist ein Verfahren zur Prüfung durch Dritte, das folgende Anforderungen erfüllen muss:
- Es muss unter transparenten, fairen und nicht diskriminierenden Bedingungen allen Unternehmen offenstehen, die bereit und in der Lage sind, die Anforderungen zu erfüllen.
- Die inhaltlichen Anforderungen müssen vom Systemträger in Abstimmung mit relevanten Fachleuten und Interessengruppen entwickelt worden sein.
- Es muss Verfahren zum Umgang mit Verstößen sowie Regelungen zur Aussetzung oder zum Entzug des Siegels geben.
- Die Überwachung der Einhaltung erfolgt objektiv und durch eine unabhängige dritte Partei, deren Kompetenz und Unabhängigkeit sich auf internationale, unionsweite oder nationale Normen und Verfahren stützt. Diese Vorgaben haben erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen, die eigene interne Labels verwenden. Sie könnten gezwungen sein, diese entweder einzustellen oder öffentlich zugänglich zu machen und in die Verantwortung einer unabhängigen Instanz zu überführen.
- Aussagen zur künftigen Umweltleistung: Aussagen über eine zukünftige Umweltleistung, etwa „klimaneutral bis 2030“ oder ähnliche Ziele, sind unzulässig, wenn sie nicht durch klare, objektive, öffentlich zugängliche und überprüfbare Verpflichtungen des Unternehmens gestützt werden, die in einem detaillierten und realistischen Umsetzungsplan dargelegt sind, der zeigt, wie diese Ziele erreicht werden sollen, und welcher die dafür nötigen Ressourcen zuweist.
- Dieser Umsetzungsplan muss Folgendes enthalten:
- messbare und zeitlich klar definierte Zielvorgaben
- weitere relevante Elemente wie finanzielle Mittel und technologische Entwicklungen
- eine regelmäßige Überprüfung durch eine unabhängige dritte Partei, die vom Unternehmen unabhängig ist und keinen Interessenkonflikten unterliegt
- die Ergebnisse dieser Überprüfung müssen den Verbrauchern zugänglich gemacht werden. Bloße Absichtserklärungen reichen künftig nicht mehr aus. Erforderlich sind konkrete, überprüfbare Pläne und eine veröffentlichte, glaubwürdige Kontrolle. Für Marken, die langfristige Nachhaltigkeitsziele kommunizieren möchten, bedeutet das: ernsthafte strategische Planung ist unerlässlich.

IV. Die weitergehende Wirkung: Weitere Verbraucherschutzmaßnahmen
Auch wenn der Fokus häufig auf Umweltaussagen liegt, führt die EmpCo-Richtlinie wichtige Verbraucherschutzvorgaben ein, die über Nachhaltigkeit hinausgehen. Ziel ist es, Transparenz und Fairness in weiteren zentralen Bereichen zu stärken und so fundiertere Kaufentscheidungen zu ermöglichen.
Haltbarkeit und Reparierbarkeit: Der Produktlebenszyklus im Mittelpunkt
Die Richtlinie positioniert sich klar gegen Praktiken, die die Lebensdauer von Produkten verkürzen oder Reparaturen erschweren – und damit sowohl Frustration auf Verbraucherseite als auch unnötige Umweltbelastung fördern.
- Keine absichtliche Begrenzung der Produktlebensdauer durch Design oder Softwareupdates: Es ist künftig verboten, in der kommerziellen Kommunikation für Produkte zu werben, die bewusst so gestaltet wurden, dass ihre Lebensdauer eingeschränkt ist – insbesondere dann, wenn das Unternehmen von diesen Einschränkungen und ihren Auswirkungen weiß. Damit werden gezielt Praktiken der „geplanten Obsoleszenz“ adressiert, bei denen Produkte absichtlich früher unbrauchbar gemacht werden.
- Beispiel: Dazu zählen etwa Softwarefunktionen, die die Leistung nach einem bestimmten Zeitraum herabsetzen, oder Hardwarebauteile, die nach einer festgelegten Anzahl an Nutzungen ausfallen.
- Pflicht zur Information über negative Auswirkungen von Softwareupdates: Unternehmen dürfen künftig Informationen über Softwareupdates, die die Nutzung von Produkten mit digitalen Elementen oder digitalen Inhalten negativ beeinflussen, nicht mehr zurückhalten.
- Beispiel: Wenn ein Smartphone-Update die Akkulaufzeit verkürzt, Apps verlangsamt oder die allgemeine Reaktionszeit verschlechtert, müssen Verbraucher vor der Installation darüber informiert werden. Auch die Darstellung eines Updates als „notwendig“, wenn es lediglich neue Funktionen bringt, ist unzulässig.
- Wahrheitsgemäße Angaben zur Reparierbarkeit und Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Anleitungen: Es ist künftig untersagt, fälschlich zu behaupten, ein Produkt sei reparierbar, wenn das nicht zutrifft. Falls es auf EU-Ebene keinen einheitlichen Reparatur-Score gibt, müssen Hersteller dennoch alle relevanten Informationen zur Reparierbarkeit bereitstellen, die vom Produzenten verfügbar gemacht wurden.
- Beispiel: Dazu gehören Angaben zur Verfügbarkeit und zu den ungefähren Kosten von Ersatzteilen, Bestellverfahren, Zugang zu Reparatur- und Wartungsanleitungen sowie Hinweise auf etwaige Reparatureinschränkungen.
Verbesserte vorvertragliche Informationen: Klarheit vor dem Kauf
Die Richtlinie stärkt die Informationen, die Verbraucher vor dem Kauf erhalten, insbesondere bei Fernabsatzverträgen. Ziel ist es, dass alle wesentlichen Details frühzeitig und transparent vorliegen.
- Klare Hinweise auf die gesetzliche Gewährleistung (mindestens 2 Jahre): Verbraucher müssen eine standardisierte Mitteilung erhalten, die sie an das Bestehen und die wesentlichen Elemente der gesetzlichen Gewährleistung für Waren erinnert, einschließlich der Mindestdauer von zwei Jahren. So wird sichergestellt, dass die Grundrechte EU-weit einheitlich verständlich kommuniziert werden.
- Haltbarkeitsbezogene kommerzielle Garantien (wenn länger als 2 Jahre) müssen mit einem standardisierten Label kenntlich gemacht werden: Bietet ein Hersteller eine kostenlose kommerzielle Haltbarkeitsgarantie für das gesamte Produkt an, die länger als zwei Jahre gilt, muss diese Garantie über ein standardisiertes EU-Label ausgewiesen werden.
- Beispiel: Dieses Label sollte leicht erkennbar sein, etwa direkt auf der Verpackung oder deutlich sichtbar im Verkaufsregal.
- Informationen über Mindestzeiträume für Softwareupdates (einschließlich Sicherheitsupdates): Bei Produkten mit digitalen Elementen, digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen müssen Hersteller oder Anbieter darüber informieren, über welchen Mindestzeitraum hinweg sie sich verpflichten, Software- und insbesondere Sicherheitsupdates bereitzustellen.
- Neu für umweltbewusste Verbraucher: Informationen über umweltfreundliche Lieferoptionen: Unternehmen sind nun verpflichtet, über die Verfügbarkeit umweltschonender Versandoptionen zu informieren.
- Beispiel: Dazu gehören etwa Lieferungen per Lastenrad oder Elektrofahrzeug oder die Möglichkeit des gebündelten Versands, sofern solche Optionen verfügbar sind. Ziel ist es, Verbrauchern nachhaltigere Kaufentscheidungen auch jenseits des Produkts selbst zu ermöglichen.

V. Was Marken jetzt tun müssen
Mit der vollständigen Anwendbarkeit der EmpCo-Richtlinie ab dem 27. September 2026 ist es entscheidend, frühzeitig Maßnahmen zur Umsetzung zu ergreifen. Dabei steht nicht nur die rechtliche Absicherung im Vordergrund, sondern auch der Aufbau von Vertrauen in einem Markt, der sich zunehmend an Transparenz und Nachhaltigkeit orientiert.
1. Bestehende Aussagen und Kennzeichnungen überprüfen
Eine umfassende Überprüfung aller bestehenden Marketingaussagen und Produktkennzeichnungen, insbesondere solcher auf Verpackungen und Labels, ist notwendig. Umwelt- und Nachhaltigkeitsaussagen müssen klar und belegbar sein.
- Allgemeine Aussagen: Begriffe wie „umweltfreundlich“ oder „grün“ dürfen nur verwendet werden, wenn eine anerkannte und belegbare hervorragende Umweltleistung vorliegt.
- Empfehlung: Vage Aussagen sollten durch präzise, überprüfbare Fakten ersetzt werden.
- Gesamtaussagen: Umweltaussagen über das gesamte Produkt oder Unternehmen sind irreführend, wenn sich der Vorteil nur auf einen Teilaspekt oder eine nicht repräsentative Aktivität bezieht.
- Empfehlung: Aussagen sollten den tatsächlichen Umfang des Umweltvorteils korrekt abbilden.
- Kompensationsbasierte Aussagen: Bezeichnungen wie „klimaneutral“, die ausschließlich auf Kompensation beruhen, sind künftig unzulässig.
- Empfehlung: Der Fokus sollte auf tatsächlichen Reduktionen innerhalb der Wertschöpfungskette liegen. Investitionen in Umweltprojekte dürfen weiterhin kommuniziert werden, müssen aber klar von produktbezogenen Aussagen getrennt werden.
- Zukunftsversprechen: Ziele wie „klimaneutral bis 2030“ sind nur zulässig, wenn sie auf klaren, öffentlich zugänglichen und überprüfbaren Verpflichtungen beruhen, die in einem detaillierten Umsetzungsplan dargelegt und überwacht werden.
- Empfehlung: Nachhaltigkeitsziele sollten mit konkreten Zeitplänen, Daten und externer Überprüfung hinterlegt werden.
- Selbstverständliche Aussagen: Leistungen, die bereits gesetzlich vorgeschrieben oder Branchenstandard sind, dürfen nicht als Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben werden.
- Empfehlung: Nur Maßnahmen und Merkmale kommunizieren, die über gesetzliche Mindeststandards hinausgehen.
- Vergleiche: Vergleiche auf Basis von Umwelt- oder Sozialkriterien sind nur zulässig, wenn die Vergleichsmethodik, die berücksichtigten Produkte und Anbieter sowie Maßnahmen zur Aktualität der Daten transparent dargelegt werden.
- Empfehlung: Vergleichsdaten und -methoden sollten klar dokumentiert und für Verbraucher leicht verständlich zugänglich gemacht werden.
2. In Transparenz und umfassende Produktinformationen investieren
Die Richtlinie zielt darauf ab, Verbraucher durch klare und verlässliche Informationen zu stärken. Im Mittelpunkt stehen dabei nachvollziehbare Maßnahmen und belastbare Daten entlang des gesamten Produktlebenszyklus.
- Nachhaltigkeitslabel überprüfen: Selbst entwickelte Nachhaltigkeitssiegel sind künftig nicht mehr zulässig. Zulässige Labels müssen entweder von öffentlichen Stellen eingeführt worden sein oder auf einem Zertifizierungssystem durch unabhängige Dritte beruhen, das strenge Anforderungen erfüllt.
- Empfehlung: Bestehende Siegel sollten auf ihre Konformität geprüft und gegebenenfalls angepasst oder abgeschafft werden.
- Ehrliche Kommunikation zur digitalen Produktleistung: Informationen über Softwareupdates, die sich negativ auf die Funktionalität eines digitalen Produkts auswirken, dürfen nicht zurückgehalten werden. Auch ein Update als „notwendig“ zu bezeichnen, wenn es lediglich neue Funktionen hinzufügt, ist unzulässig.
- Empfehlung: Klare und frühzeitige Hinweise zu möglichen Auswirkungen von Updates bereitstellen.
- Haltbarkeit und Reparierbarkeit klar kommunizieren
- Vermeidung geplanter Obsoleszenz: Produkte dürfen keine absichtlich eingebauten Merkmale enthalten, die die Lebensdauer einschränken, sofern das Unternehmen darüber Kenntnis hat. Eine entsprechende Bewerbung wäre unzulässig.
- Realistische Haltbarkeitsangaben: Aussagen zur Haltbarkeit müssen der tatsächlichen Nutzungspraxis entsprechen und dürfen nicht überhöht dargestellt werden.
- Transparenz bei Reparaturmöglichkeiten: Es müssen realistische Informationen zur Reparierbarkeit, zur Verfügbarkeit und zu den Kosten von Ersatzteilen sowie zum Zugang zu Reparatur- und Wartungsanleitungen gegeben werden. Wo vorhanden, ist der standardisierte Reparaturscore zu verwenden.
- Verbrauchsmaterialien: Es ist unzulässig, einen verfrühten Austausch von Verbrauchsteilen zu fördern oder die Funktionalität durch den Einsatz nicht-originaler Teile falsch darzustellen.
- Empfehlung: Klare Informationen zu kommerziellen Haltbarkeitsgarantien bereitstellen und sicherstellen, dass Verbraucher den standardisierten Hinweis zur gesetzlichen Gewährleistung erhalten.
- Informationen zu Softwareupdate-Zeiträumen bereitstellen: Bei digitalen Produkten und Dienstleistungen müssen Verbraucher darüber informiert werden, über welchen Mindestzeitraum Software- und Sicherheitsupdates bereitgestellt werden.
- Empfehlung: Die zugesicherten Update-Zeiträume transparent und klar kommunizieren.
- Umweltfreundliche Lieferoptionen sichtbar machen: Wo verfügbar, sollten umweltschonende Versandmöglichkeiten kommuniziert werden.
- Empfehlung: Optionen wie Lieferung per Lastenrad, Elektrofahrzeug oder gebündelter Versand deutlich hervorheben.
3. Teams intern sensibilisieren und weiterbilden
Die EmpCo-Richtlinie bringt umfassende Veränderungen mit sich, die sich auf alle Unternehmensbereiche auswirken – von Produktentwicklung über Marketing bis hin zu Recht und Einkauf.
- Empfehlung: Alle relevanten Teams in den Bereichen Marketing, Produktmanagement, Recht, Forschung und Entwicklung sowie Lieferkette sollten ein gemeinsames Verständnis der neuen Anforderungen entwickeln. Transparenz und Verantwortungsbewusstsein sollten von der Produktidee bis zur Kommunikation fest verankert sein.
4. Digitale Werkzeuge nutzen
Neue Technologien können dabei helfen, die gestiegenen Anforderungen an Transparenz effizient zu erfüllen.
- Empfehlung: Der Einsatz digitaler Lösungen wie info.link in Kombination mit GS1 Digital Link-QR-Codes bietet die Möglichkeit, Verbraucherinnen und Verbrauchern detaillierte und überprüfbare Informationen zu Umweltaspekten und Haltbarkeit eines Produkts bereitzustellen.

5. Wandel aktiv vorbereiten
Die EmpCo-Richtlinie, die spätestens ab dem 27. September 2026 in nationales Recht überführt und angewendet werden muss, steht für einen tiefgreifenden Wandel. Sie ist ein erster großer Schritt der EU in Richtung deutlich strengerer Vorgaben für Umweltwerbung und Teil eines einheitlichen Systems für den Verbraucherschutz.
- Empfehlung: Die Richtlinie sollte nicht als Belastung, sondern als Chance verstanden werden, die eigene Marke glaubwürdig im Bereich Nachhaltigkeit zu positionieren. Rechtsprechung und Marktanforderungen orientieren sich bereits zunehmend an den EmpCo-Vorgaben. Wer frühzeitig handelt, verschafft sich einen klaren Vorteil.
VI. Fazit: Vertrauen stärken für eine nachhaltigere Zukunft
Die EmpCo-Richtlinie ist nicht einfach nur eine weitere gesetzliche Vorgabe, sondern ein deutliches Signal der EU für eine neue Ära glaubhafter Nachhaltigkeit. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Verbraucher mit verlässlichen Informationen auszustatten, damit ihre Entscheidungen tatsächlich zu einer grüneren Zukunft und den ambitionierten Klimaneutralitätszielen der EU beitragen können.
Compliance als Wettbewerbsvorteil
Der aktuelle Wandel bietet Marken eine einmalige Chance. Compliance sollte nicht als Belastung verstanden werden, sondern als strategischer Vorteil. Warum? Weil Verbraucher bereit sind, Authentizität zu belohnen.
- Zahlungsbereitschaft: 80 % der Verbraucher sind bereit, mehr für nachhaltig produzierte Produkte zu zahlen, selbst bei wirtschaftlichem Druck. Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr, sondern ein zentraler Kaufanreiz. (PwC 2024 Voice of the Consumer Survey)
- Wunsch nach Transparenz: 64 % der Konsumenten würden die Marke wechseln, wenn ein anderes Produkt umfassendere Informationen bietet. 93 % möchten genau wissen, was in ihrem Essen steckt und wie es hergestellt wurde. Versprechen allein reichen nicht mehr, gefragt sind Belege. (FMI/NielsenIQ report)
- Digitale Informationsnutzung: Vertrauen entsteht zunehmend digital. In Deutschland interessieren sich 84 % der Verbraucher für Lebensmittelinformationen per QR- oder Barcode auf dem Smartphone. 40 % nutzen solche Funktionen bereits aktiv. Die Erwartung an digitale Transparenz steigt und entspricht den Anforderungen der EmpCo-Richtlinie. (bitkom)
- Wandelnde Konsumprioritäten: Konsumenten suchen gezielt nach konkreten Nachhaltigkeitskennzeichnungen. In Deutschland hat sich etwa die Aufmerksamkeit für Tierwohl-Siegel seit 2015 nahezu verdoppelt (65 %). Auch EU-Bio-Siegel (59 %) und pflanzenbasierte Angebote (39 %) gewinnen an Bedeutung. (Nutrition Report 2024)
Wer die Anforderungen der EmpCo-Richtlinie frühzeitig erfüllt, kann diese starke Verbrauchernachfrage gezielt nutzen, langfristiges Vertrauen aufbauen und Markenbindung schaffen, die über kurzfristige Trends hinausgeht. Compliance ist damit nicht nur Risikominimierung, sondern der Schlüssel zu Wachstum und Marktführerschaft in einer bewussten Konsumwelt.
Die Zukunft der Markenführung ist authentisch und transparent
Die Zukunft der Markenführung ist klar: Sie ist transparent, glaubwürdig und wirklich nachhaltig. Die EmpCo-Richtlinie markiert eine unumkehrbare Wende hin zu einem Markt, in dem nur nachweisbare ökologische und soziale Leistungen das Vertrauen der Verbraucher gewinnen. Jetzt ist der Moment, in dem Marken die Führung übernehmen können: durch neue Wege der Kommunikation, durch echte Wirkung und durch den Aufbau eines Vertrauens, das den Werten heutiger und zukünftiger Konsumenten entspricht. Wer diesen Wandel annimmt, wird nicht nur den neuen regulatorischen Rahmen meistern, sondern in ihm erfolgreich wachsen.
FAQHäufig gestellte Fragen
Autor
Max Ackermann
Max Ackermann ist Gründer & CEO von info.link, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Hamburg und Berlin. info.link hilft Brands, Produkte in smarte, compliance-konforme digitale Touchpoints zu verwandeln. Max bringt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau digitaler Businesses mit und leitete bei McKinsey die Design- und Corporate Venture Teams in Europa. Außerdem hat er digitale Produkte und Plattformen für globale Marken wie Nike, Google, Meta und Airbnb entwickelt. Max unterstützt Brands dabei, GS1-standardisierte Digital Labels zu erstellen, um Green Claims, Digital Product Passports, Produktinformationen, Promotions und mehr zu teilen. Er ist Experte für QR Codes, Green Claims, EU-Regulatorik, multilingual Digital Labeling und ist Fellow der Higher Education Academy in Großbritannien.